Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) war vieles zugleich: Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker, Erfinder, Theologe – und, würde man heute sagen, eine echte Scannerpersönlichkeit. Seine unstillbare Neugier, sein Wille, die Welt als Ganzes zu verstehen, und seine Fähigkeit, Verbindungen zwischen scheinbar fremden Wissenswelten zu schaffen, machen ihn zu einem zeitlosen Vorbild.
Leibniz zeigt, dass Vielseitigkeit nicht bedeutet, sich zu verzetteln. Sie stellt vielmehr eine besondere Form schöpferischer Intelligenz dar. Wer viele Interessen hat, zwischen Themen springt oder neugierig auf vieles ist, findet in ihm einen inspirierenden Weggefährten. Denn Leibniz lebte das, was wir heute Interdisziplinarität nennen – lange bevor es dieses Wort überhaupt gab.
Wie bin ich darauf gestoßen? Auf meinen wissenshungrigen Streifzügen in YouTube habe ich eine wunderbare Dokumentation über Leibniz entdeckt: Leibniz – das größte Genie aller Zeiten? Infotainment in seiner schönsten Form. Ich bin sehr inspiriert davon und finde Ansatzpunkte für uns vielseitig interessierte Menschen.
Lies bis zum Schluss, wenn du herausfinden willst, was Leibniz mit den berühmten Leibniz Butterkeksen zu tun hatte! 🍪
✨ Warum Leibniz das perfekte Vorbild für vielseitig Interessierte (=Scannerpersönlichkeit) ist
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) gilt als Universalgenie – also als einer der letzten Menschen, die in fast allen damals bekannten Wissensgebieten bedeutende Beiträge leisteten. Was ihn besonders macht, ist die enorme Breite und Tiefe seines Denkens, kombiniert mit einem einheitlichen Welt- und Erkenntnisverständnis.
Der Begriff Scannerpersönlichkeit (nach Barbara Sher) bezeichnet Menschen, die:
-
viele Interessen gleichzeitig haben,
-
schnell lernen und sich für Neues begeistern,
-
nicht bei einem Thema bleiben, sondern Zusammenhänge zwischen vielen Disziplinen suchen.
Leibniz war dafür das Paradebeispiel – ein Mensch, der in alle Richtungen gleichzeitig dachte. Hier sind die wichtigsten Punkte seines Schaffens:
1. Enzyklopädisches Wissen und Schaffensbreite
Leibniz war Philosoph, Mathematiker, Logiker, Physiker, Jurist, Historiker, Sprachwissenschaftler, Theologe, Diplomat und Erfinder.
Er verfasste über 15.000 Briefe an fast alle großen Gelehrten Europas und verfolgte das Ideal, alles Wissen miteinander zu verbinden – ein echter Vorläufer moderner interdisziplinärer Forschung.
2. Revolutionäre Beiträge in der Mathematik und Informatik
-
Differenzial- und Integralrechnung: Leibniz entwickelte sie unabhängig von Newton, führte aber die bis heute verwendete Symbolik ein (z. B. ∫ und dx).
-
Binärsystem: Er erkannte, dass sich alle Zahlen durch 0 und 1 darstellen lassen – die Grundlage der modernen Digitaltechnik und Informatik.
-
Mechanische Rechenmaschine: Er erfand eine Maschine, die addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren konnte – ein Vorläufer des Computers. Er war damit seiner Zeit absolut voraus, auch wenn sie noch nicht vollständig funktionierte.
3. Philosophie: Harmonie und Vernunft
Leibniz’ Philosophie war von Optimismus und systematischer Vernunft geprägt:
-
Er entwickelte die Lehre der Monaden – kleinster geistiger Einheiten, die das Universum bilden.
-
Mit der Idee der „prästabilierten Harmonie“ versuchte er, Geist und Körper philosophisch zu verbinden.
-
Er vertrat den berühmten Satz: „Dies ist die beste aller möglichen Welten“ – Ausdruck seines Glaubens an eine göttlich geordnete, rationale Welt.
4. Geist der Aufklärung und Wissenschaftsorganisation
-
Leibniz war Mitbegründer wissenschaftlicher Akademien (z. B. der Preußischen Akademie der Wissenschaften) und setzte sich für eine Vernetzung des Wissens in Europa ein.
-
Er wollte eine „Encyclopaedia universalis“ schaffen – ein Vorläufer der späteren Enzyklopädien.
5. Was ihn in seiner Zeit besonders machte
In einer Epoche, in der Wissen zunehmend spezialisiert wurde, blieb Leibniz ein Universalgelehrter, der alles – von Mathematik bis Theologie – in einem einheitlichen System zu denken versuchte.
Er verband rationale Wissenschaft mit metaphysischem Denken, praktische Erfindung mit philosophischer Tiefe, Einzelwissen mit Welterkenntnis.
🧠 Was machte Leibniz so genial?
Dazu gehörten offenbar verschiedene Faktoren, innere und äußere.
Die Basis: Hochbegabung und Hochverknüpfung
Mein Eindruck aus der Dokumentation war, dass Leibniz
- höchstintelligent gewesen sein muss,
- dass er hochverknüpfend dachte und zudem
- ungebremst seinem Wissensdurst und seinem Erkenntnisdrang nachging.
Einerseits beneidenswert, aber ich weiß nicht, ob er auf regelmäßige Mahlzeiten achtete!
Morgens noch im Bett liegend hatte er so viele Ideen, dass er Stunden oder Tage brauchte, um diese halbwegs schriftlich festzuhalten. Vermutlich kam er selten gedanklich zur Ruhe. Auch das kennen viele von uns.
Aber Leibniz wurde so, wie er war, auch durch die fördernden Rahmenbedingungen seiner Zeit. Leibniz’ Umfeld machte seine Vielseitigkeit überhaupt erst möglich:
Humanistische Bildung
-
Schon als Kind erhielt er Zugang zu einer riesigen Bibliothek seines Vaters (Universität Leipzig) und las dort eigenständig, was ihn interessierte.
-
Er brachte sich Latein und Griechisch selbst bei, um mit 12 Jahren Philosophen im Original lesen zu können. In diesen Sprachen korrespondierte er später mit Gelehrten im Ausland.
-
Der Humanismus der Zeit betonte breite Bildung – das Ideal des homo universalis (der allseitig gebildete Mensch).
Frühe Neuzeit & Aufklärung
-
Die Zeit war geprägt von Wissensdrang, Neugier und Systemdenken: Astronomie, Naturwissenschaft, Philosophie – alles im Umbruch.
-
Es gab noch keine strenge Spezialisierung der Wissenschaften wie heute. Wer klug war, konnte sich überall einbringen.
-
Leibniz war viel auf Reisen (Paris, London, Wien) und hatte Kontakt mit führenden Köpfen Europas, was sein Denken erweiterte.
Gesellschaftliche Stellung
-
Als Berater und Diplomat hatte er finanzielle Sicherheit und intellektuelle Freiheit – er musste sich nicht auf ein Fachgebiet beschränken, um zu überleben.
-
Seine Position als Gelehrter an Fürstenhöfen (z. B. Hannover) erlaubte ihm, Wissenschaft als Dienst an der Menschheit und Politik zu sehen. Besonders schön wird in der Dokumentation herausgearbeitet, dass die Schwester des Fürsten von Hannover ihm eine interessierte Freundin und Gesprächspartnerin war, was beide bereicherte. (Sophie Charlotte von Hannover, später Königin von Preußen).
Was er sich selbst erarbeitet hat
Leibniz war nicht nur ein „Naturtalent“. Er formte sich aktiv zu dem, was er war:
- Er war unglaublich fleißig: schrieb täglich, führte akribische Notizen, entwickelte Ordnungssysteme für Wissen – wie ein analoges Wikipedia.
- Er glaubte, dass alles Wissen durch klare Logik verbunden werden kann – daher sein Traum von einer „Characteristica universalis“, einer Universalsprache der Vernunft.
- Außerdem sah Leibniz Wissen als Gemeinschaftsprojekt: Er schrieb mit Hunderten von Gelehrten, sammelte Ideen, und verband sie.
- Er verstand Kommunikation als Werkzeug der Erkenntnis – ein Merkmal vieler Scannerpersönlichkeiten, die im Austausch inspiriert werden.
Leidenschaft für Verknüpfung
-
Sein Denken war vernetzend, nicht additiv: Er wollte keine Faktenhäufung, sondern Zusammenhänge.
-
Beispiel: Er verband Mathematik (Logik, Strukturen) mit Philosophie (Wahrheit, Vernunft) und Theologie (Ordnung Gottes).
→ Das machte ihn zu einem Denker, der Disziplinen „überbrückte“, lange bevor es das Wort interdisziplinär gab.
📜 Leibniz’ Notizen: Ein „papiernes Gehirn“ – oder seine losen Scanner-Ideenbücher?
Leibniz hinterließ über 90.000 Manuskriptseiten! Und diese Zettel sind keine zufällige Ansammlung, sondern Teil eines methodischen Denkexperiments:
-
Er wollte Wissen nicht nur sammeln, sondern strukturieren – fast wie ein früher Datenbankdesigner.
-
Viele Zettel zeigen Verknüpfungen, „Verweisnummern“ und Themenhierarchien.
-
Er arbeitete mit Indexsystemen, Symbolen und Abstraktionen (z. B. zur „Characteristica universalis“, einer universellen Wissenschaftssprache).
-
Sein Ziel war, die Welt logisch abbildbar zu machen – Wissen als Netzwerk, nicht als lineare Liste.
Noch lange nicht sind alle Manuskriptseiten gescannt und katalogisiert. Teils liegen sie in kleinen Streifen vor, weil der Gelehrte seine Gedanken am Stück notierte, dann aber nach Themen auseinanderschnitt und gruppierte. Mir wird ganz schwummrig, wenn ich daran denke.
Viele Schätze warten noch darauf, von der Wissenschaft entdeckt zu werden.
💡 Warum Leibniz ein Vorbild für vielseitige Menschen ist
Leibniz war kein Spezialist, sondern jemand, der sein Leben lang mit Neugier, Ordnungsliebe und Begeisterung die Welt erkundete.
Er zeigt, dass man Breite nicht als Schwäche, sondern als Potenzial verstehen kann.
Er verkörpert drei Haltungen:
-
Neugier als Lebensprinzip – alles ist interessant, wenn man den Zusammenhang erkennt.
-
Verknüpfendes Denken – Wissen bekommt Sinn erst im Zusammenhang.
-
Optimismus des Geistes – Lernen und Denken sind ein Beitrag zur Harmonie der Welt.
Leibniz war überzeugt:
„Es gibt in der Welt nichts, das nicht in Beziehung zu allem anderen steht.“
Das ist ein Satz, der Scannerpersönlichkeiten Mut macht: Deine vielen Interessen sind kein Chaos – sie sind ein Netzwerk.
👨🏼🎓 Was wir konkret von Leibniz lernen können
(1) Vernetztes statt lineares Denken
Leibniz sah Wissen nicht als Baum mit einem Stamm, sondern als Netzwerk von Knoten.
Lerne, Querverbindungen zu sehen: zwischen Kunst und Technik, Philosophie und Alltag, Sprache und Natur.
Praktisch: Nutze Mindmaps, Zettelkästen oder digitale Tools (z. B. Programme wie Obsidian, Notion), um dein Denken zu vernetzen
(2) Ordnung als kreative Struktur
Leibniz war kein chaotischer Sammler, sondern suchte Strukturen, um Komplexität zu bändigen.
Vielfalt braucht ein System, sonst verliert sie sich.
Praktisch: Entwickle dein persönliches Ordnungssystem – Kategorien, Tags, Themencluster, oder Fragen, an denen du deine Notizen misst („Was verbindet das?“).
(3) Neugier disziplinieren
Leibniz’ Stärke war: Er ließ sich begeistern, aber er arbeitete seine Interessen aus.
Scanner-Seele + Ausdauer = schöpferische Kraft.
Praktisch: Wenn dich etwas interessiert, schreib nicht nur Zitate ab – formuliere eigene Gedanken, ziehe Schlüsse, stelle Hypothesen auf.
(4) Schreiben = Denken
Leibniz schrieb nicht, weil er etwas wusste, sondern um zu wissen.
Schreiben ist Werkzeug des Denkens, nicht nur Dokumentation.
Praktisch: Führe ein Denk- oder Ideenjournal, in dem du deine Gedanken fortspinnst, statt sie nur zu speichern.
(5) Neugier mit Ethik verbinden
Leibniz war überzeugt, dass Wissen dem Guten dienen sollte – der Verbesserung des Lebens, des Friedens, des Verständnisses.
Lernen ist für ihn immer sinnstiftend, nicht Selbstzweck.
Praktisch: Frag dich bei jedem Interesse: Wie kann dieses Wissen etwas zum Ganzen beitragen – für mich, für andere, für die Welt?
🤩 Was mich als Scannerpersönlichkeit daran inspiriert hat
Mich mit Leibniz zu befassen, hat mich aus vielen Gründen inspiriert und beflügelt. Es wirkt so ermutigend, wenn jemand sein Potenzial und seine Eigenart so erfolgreich auslebt.
Ich will meine drei wichtigsten Inspirationen nennen – Punkte, die ich an Leibniz bewundere:
- Er übte das zusammenhängende, gründliche Denken durch Schreiben, Konversation und Briefwechsel. – Könnte ich das noch mehr kultivieren?
- Offenbar war er ein freundlicher, verträglicher Charakter, der mit anderen Menschen gut auskam. – Kann ich das noch mehr üben, für ein gutes, produktives Leben?
- Und er war Optimist, hatte starke ethische Werte und glaubte an das Gute in der Welt, trotz aller reichlich vorhandenen Schwierigkeiten in der Welt. – Kann ich auch das vertiefen, um gut durch diese Zeiten zu kommen?
Was ziehst du für dich daraus? In welchen Aspekten deiner Interessen und deines Denkens bestärkt dich die Information über das Universalgenie und die Scannerpersönlichkeit Leibniz?
🍪 Was hat das Universalgenie Leibniz mit den Butterkeksen zu tun?
Und jetzt – wie versprochen – zu den Butterkeksen.
Ich dachte, der Gelehrte hat vielleicht auch Rezepte für Butterkekse erfunden. Weit gefehlt!
Der berühmte „Leibniz Butterkeks“ wurde in den 1890er Jahren von der Hannoverschen Keksfabrik Bahlsen eingeführt.
Der Firmenchef Hermann Bahlsen suchte für sein neues Buttergebäck einen gebildeten, anspruchsvollen Markennamen – etwas, das Kultur, Qualität und Intelligenz ausstrahlt.
Da Gottfried Wilhelm Leibniz lange Zeit in Hannover lebte und auch dort starb, und nachdem er als einer der größten Denker der deutschen Geschichte galt, wählte Bahlsen seinen Namen als Markenzeichen. Die Firma warb mit einem Leibniz-Zitat: „Es ist besser, etwas mehr zu wissen, als man braucht, als weniger.“
So, das war ein Streifzug durch die Welt des Wissens.
Vielseitig interessierte Menschen finden wir zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten.
Vielleicht war Leibniz’ größter Gedanke gar nicht die Differentialrechnung, sondern die Idee, dass alles miteinander verbunden ist.
Wenn wir das ernst nehmen, dann ist jedes Interesse, jede Idee, jeder Gedanke Teil eines größeren Musters – und unsere Neugier selbst ein Ausdruck dieser Harmonie.
Lass mir einen Kommentar da,
und gute neugierige Forschung wünsche ich dir!
![]()
Quellen
- Wikipedia-Artikel über Leibniz.
- Wikipedia-Artikel über die Bahlsen-Kekse.
- Wikipedia-Artikel über Sophie Charlotte von Hannover – tolle Frau!
- Hier noch einmal die zauberhafte Dokumentation auf YouTube (Länge fast eine Stunde), die ich dir sehr ans Herz lege: Leibniz – das größte Genie aller Zeiten?
- Außerdem habe ich mir bei diesem Artikel und dem Bild von ChatGPT helfen lassen.
Ähnliche Artikel
- Artikel über die „12 Lieblingsprobleme von Richard Feynman“: Vielseitigkeit meistern: 12 Lieblingsprobleme – Produktivitätsstrategie eines Nobelpreisträgers
- Zu viele Interessen? Oder von Natur aus vielseitig? [Scanner, Renaissance-Mensch]
P.S.: Leibniz als Polyglott
Wenn du bis hierher gelesen hast, noch einen Bonus für dich! Leibniz beherrschte auch mehrere Sprachen:
Leibniz beherrschte aktiv (sprechen, schreiben, korrespondieren):
-
Deutsch – Muttersprache (obwohl er meist auf Latein oder Französisch schrieb).
-
Latein – seine wichtigste Wissenschaftssprache; fließend in Schrift und Rede.
-
Französisch – er sprach es sehr gut (arbeitete mehrere Jahre in Paris, schrieb viele Briefe auf Französisch).
-
Griechisch – gelernt in der Jugend, um antike Philosophen im Original zu lesen.
-
Englisch – gut lesend und schriftlich ausreichend; er korrespondierte mit Mitgliedern der Royal Society.
-
Italienisch – solide Lesekenntnisse; nutzte es für Texte aus Philosophie und Theologie.
Mit guten Lesekenntnissen oder philologischem Interesse:
-
Hebräisch – für theologische und sprachphilosophische Studien.
-
Niederländisch – durch seine Kontakte in den Niederlanden (möglicherweise passiv).
-
Chinesisch – er konnte es nicht sprechen oder lesen, aber er beschäftigte sich intensiv mit der Sprache und Schriftzeichenphilosophie (über Jesuitenberichte).
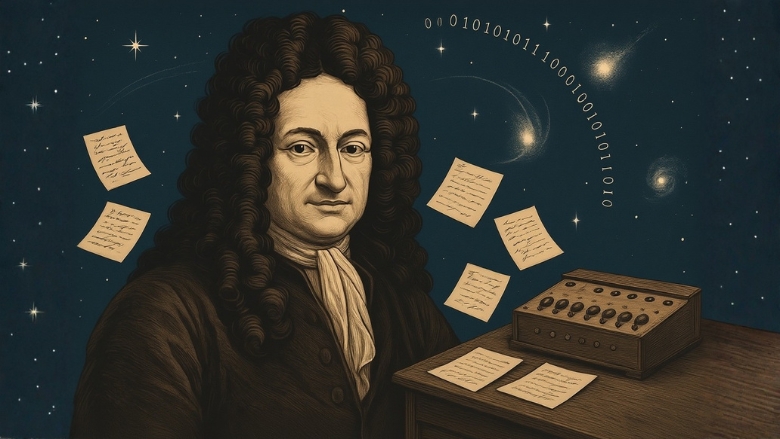
Ein sehr spannender Mensch, dieser Leibniz. Und dass er auch noch Optimist und umgänglich war, macht ihn mir gleich besonders sympathisch. Danke für die ausführliche Vorstellung – auch für deinen Scannerinnen-Blickwinkel.
Leibniz, der ja auch für seine Butterkekse bekannt ist (trotzdem keine Rezepte verfasst hat, wie man so liest!), ist wirklich das Nonplusultra. Er hat das Zeug gehabt, nicht nur eine Enzyklopädie zu erstellen, sondern gleichzeitig die Differentialrechnung zu erfunden und mit seiner Schwester zu quatschen. Der Kerl war ein echter „Scanner, der einfach nicht zum Stillstand kam. Aber was mich am meisten bewundere: Er hat seine Vielseitigkeit nicht nur bewundert, sondern aktiv gestaltet. So ein „papiernes Gehirn und die Ordnungssysteme – Beeindruckend! Aber der witzigste Teil ist ja, dass er als Universalgenie gilt und trotzdem keine Butterkeks-Recette hinterlassen hat. Das zeigt, dass man wirklich alles können kann – auch wenn man dabei vielleicht ein bisschen zu viel mit den Zetteln hantiert. Leibniz: Ein Vorbild für alle, die zu viel tun und zu wenig Kekse backen.
Ja, so kann man das wohl ausdrücken! 😂😂😂 Viele, die Webseiten betreiben, kennen zugleich das Problem mit den zu vielen Interessen. So können wir Leibniz nur bewundern, wie er das alles hinbekommen hat. Wenn er heute leben würde, würde er sicher seine Notizen diktieren und transkriberen (ich nutze dazu Whisper), in Notion (oder eher Obsidian) organisieren und mit Hilfe einer KI auswerten. Das würde ihm seine Arbeit noch leichter machen. Es ist faszinierend, dass wir heute von seiner mathematischen Arbeit so profitieren, ohne dass er es weiß.